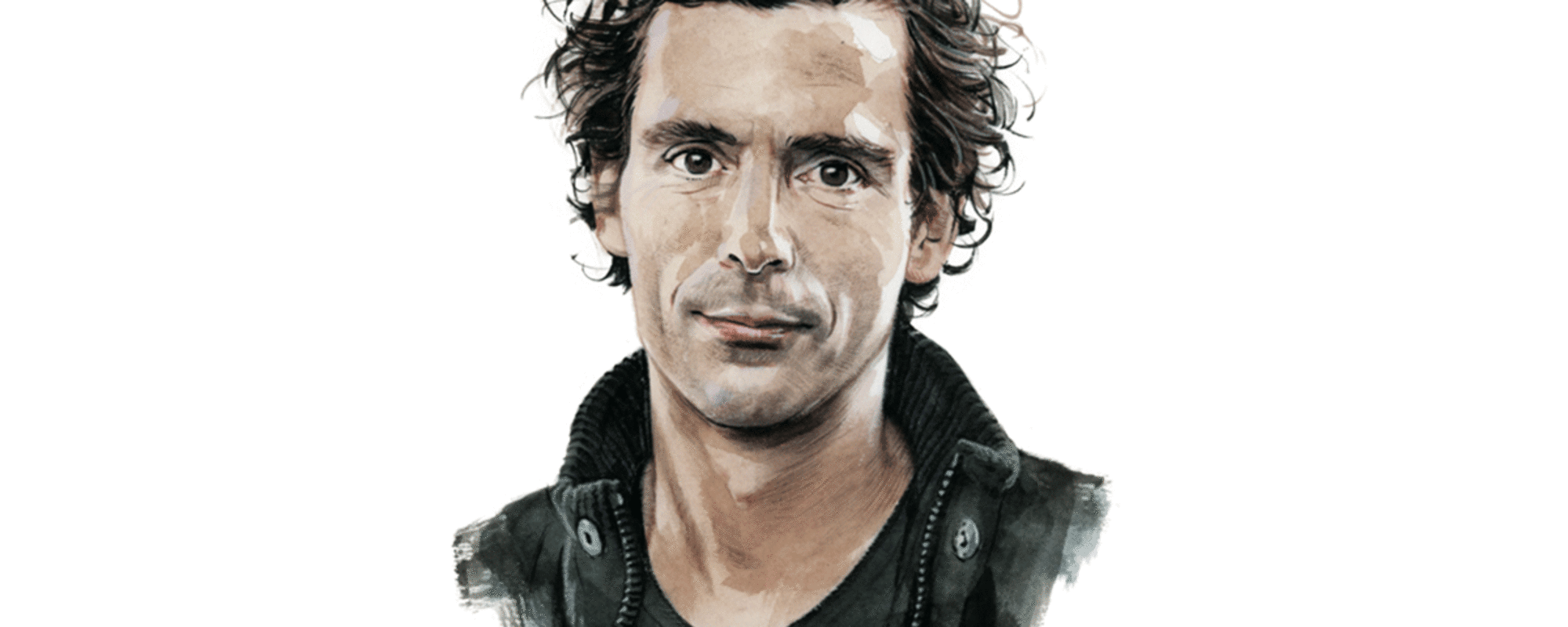
Die Logik des Vertikalen
Foto: Roland Vorlaufer
Warum das Gehen für das Denken unverzichtbar ist und Wandern oft anstrengender, als man denkt: Der Philosoph und Bergwanderführer Jens Badura im Gespräch. Das Interview ist im Bergwelten Magazin (August/ September 2018) erschienen.
„Ich stell euch jetzt mal die Berge vor“, sagt Jens Badura, als er aus der Tür seines Büros tritt. Er deutet auf den Horizont, der in diesem Fall ziemlich weit oben liegt und wo schneebedeckt der Hohe Göll und das Hohe Brett aufragen. Der berühmte Watzmann lugt gerade noch mit seinen Spitzen über den nächsten Hügel. Das Gespräch findet in Ramsau bei Berchtesgaden statt, wo Jens Badura das berg_kulturbüro leitet, einen Raum für alpinpolitische und alpinkulturelle Begegnungen. Der habilitierte Philosoph lebt in Salzburg, lehrt an der Zürcher Hochschule der Künste und arbeitet außerdem als Bergwanderführer.
Interview: Christina Geyer und Mara Simperler
Bergwelten: Was suchen Sie, wenn Sie in die Berge gehen?
Jens Badura: Ich suche neben Licht und Luft auch körperliche Anstrengung und will so dem Denken einen anderen Raum geben. Ich halte es mit Nietzsche und bin der Meinung, dass man Gedanken, bei denen nicht auch die Muskeln ein Fest feiern, nur bedingt trauen kann.
Und finden Sie, was Sie suchen?
Es dauert eine Weile. Über den Daumen gerechnet etwa 800 Höhenmeter, je nach Tag mal mehr, mal weniger.
Sie haben Friedrich Nietzsche erwähnt. Der Philosoph verbrachte sieben Sommer im Schweizer Bergdorf Sils Maria, wanderte jeden Tag mehrere Stunden und schrieb hier sein berühmtes Werk „Also sprach Zarathustra“. Er ist nicht der Einzige, für den Wanderungen zur Inspirationsquelle wurden. Wieso ist das Gehen so wichtig für das Denken?
Es ist bei uns eine traditionelle Annahme, dass das Denken vom Körper ein Stück weit unabhängig ist und auch unabhängig sein soll, weil es sonst durch körperliche Reize oder Leidenschaften korrumpiert wird. Diese Unterscheidung von Geist und Körper halte ich für problematisch. Mit dem Körper bewegt sich auch der Geist. Beim Wandern beispielsweise verändern wir mit jedem Schritt unsere Position und unsere Perspektive – und damit auch unsere Sicht auf die Welt.
Macht es dabei einen Unterschied, ob man im Wald oder am Berg unterwegs ist?
Ja, ich glaube, es gibt etwas wie eine „Logik des Vertikalen“. Die metaphernreiche Sprache im Zusammenhang mit den Bergen kommt ja nicht von irgendwoher – denken Sie an Redeweisen wie „auf dem Gipfel der Gefühle“ sein, aber auch „am Abgrund stehen“. Das sind Bilder, mit denen existentielle Fragen verhandelt werden – und die Berge liefern sie.
Was macht es also mit dem Denken, wenn der moderne Mensch zu einem Großteil in einem Büro sitzt?
Man verfällt in eine Routine – die französische Wortherkunft ist „Wegerfahrung“. Der moderne Mensch gerät in Gefahr, seine Routinen nicht mehr auf die Probe stellen zu müssen, weil alle Wege vorgegeben sind. Ich denke, dass alle Formen der Monotonie dazu führen, dass das Denken in Stereotypen landet.
Wechseln wir das Thema: Sie lehren an der Zürcher Hochschule der Künste zu „Ästhetischer Theoriepraxis“. Was ist für Sie ein schöner Berg?
Wenn man über Ästhetik in den Bergen spricht, muss man eine Unterscheidung zwischen Schönheit und Erhabenheit treffen. Das wohlige Schaudern, das mit dem Erhabenen verbunden ist, wird den Bergen häufiger zugewiesen. Mit meinem Hausberg, dem Untersberg, habe ich ein geradezu spürbares Bindungsverhältnis – da spielt eine andere Qualität als Schönheit eine Rolle.
Nämlich?
Es ist nicht seine markante Form, die mich begeistert. Ich bin jedes Mal aufs Neue berührt durch das bloße Dasein dieses Berges, sicher auch geprägt durch starke Erinnerungen und die vielen vertrauten Plätze. Wobei ich es als philosophische Herausforderung empfinde, Begriffe wie „Kraftort“ aus den Fängen esoterischer Verschwurbelung herauszuholen. Schönheit ist eigentlich nur dann eine Kategorie, wenn ich den Berg bereits als Abbild denke. Wenn ich dem Berg gerecht werden will, muss ich ihn anders wahrnehmen als nur als Foto.
Diese Abbilder der Berge in Medien kritisieren Sie. Warum?
In Magazinen und Broschüren sieht man meist Klischeealpen: Leute, die klettern und Abenteuer erleben; Menschen, die wandern und genießen; oder Menschen, die in traditionellen Kleidern auf der Alm stehen. Wenn wir Berge ernst nehmen wollen, müssen wir uns mit all ihren Dimensionen auseinandersetzen: Berge sind genauso interessant zu besteigen, wie sie Hindernisse für den Verkehr sind. Berge können eindrucksvolle Felsformationen bilden, aber auch in wüster Art und Weise auseinanderbrechen. Sie können wirtliche, aber auch extrem unwirtliche Orte sein. Die Frage ist, welche Seiten aus diesem Spektrum ich zeige und welche nicht.
Wozu führen die klischeehaften Bilder?
Man weckt Erwartungshaltungen, die oft enttäuscht werden. Häufig ist man nicht allein im Gebirge, dann ist da Sauwetter, es ist viel anstrengender, als man dachte, und macht gar nicht so viel Spaß. Und es kommt zu teils fatalen Fehleinschätzungen: Bei der Bergrettung steigen die Einsätze wegen Blockierung – also Berggeher, die sich überschätzt haben und nicht mehr vor- und zurückkönnen.
Sie arbeiten in der Ramsau, einem Ort, der von den Bergen bestimmt ist, gleichzeitig beschäftigen Sie sich mit dem Blick von außen auf die Berge. Wie beurteilen Sie die Situation hier?
Inszeniert wird überall. In der Ramsau haben wir ein zweigeteiltes Publikum: erstens klassische Wanderer und Bergsteiger, die in Ruhe zu Berg gehen wollen; zweitens diejenigen, die den Watzmann abhaken oder die Top-Five-Fotos von Hintersee und Co schießen wollen. Aber ich finde diese Schwarz-Weiß- Malerei schwierig: auf der einen Seite der böse Massentourismus und auf der anderen Seite der gute, nachhaltige Tourismus. Was die Menschen, die sich etwa in Ischgl wohlfühlen, dort schätzen, schätze ich nicht. Das heißt aber nicht, dass das, was ich schätze, wichtiger wäre.
Der Landtagsabgeordnete der Grünen Partei in Tirol, Gebi Mair, hat vorgeschlagen, dass Orte mit enormer Ski-Infrastruktur wie Ischgl zu Industriegebieten erklärt werden sollten, wo dann alles zugelassen wird in den Bergen – und dafür sollte das übrige Land zurückgebaut werden.
Den Alpen wäre jedenfalls damit mehr gedient, wenn die Leute konzentriert auf einem Haufen rumlaufen, als wenn jeder individuell sein Glück sucht und viel Platz für sich beansprucht.
Was macht den einzelnen Wanderer so problematisch?
Der einzelne Berggeher ist etwa ein enormer Verkehrsverursacher. Und es ist nicht einfach, seine individuellen Bedürfnisse mit öffentlicher Infrastruktur zu erfüllen. Genug Leute wollen morgens um vier zu Berg gehen. Da fährt kein Bus, deshalb kommt jeder mit seinem Auto ins Gebirge.
Sie sind Österreicher, leiten ein Bergbüro in Deutschland und lehren in der Schweiz – haben diese Länder unterschiedliche Bergbezüge?
Ja, diese Unterschiede haben damit zu tun, wie groß der Anteil der Bevölkerung ist, die in den Bergen oder zumindest bergnah lebt. Diese Menschen haben dazu ein viel pragmatischeres Verhältnis als jene, für die Berge ein aus der Entfernung betrachteter Sehnsuchtsraum sind. Von Norddeutschland aus gibt es also ein anderes Alpenverständnis als in Oberbayern. Die Österreicher wie auch die Schweizer nehmen die Berge als Identitätsmerkmal in Anspruch. In Deutschland sind die Berge für das nationale Selbstverständnis sicher nicht so zentral, aber gemessen an dem, wie klein der Anteil der Bergregionen am Land ist, spielen sie eine größere Rolle, als man denken könnte. Schon an den Namen der Hütten kann man sehen, wie sehr sich auch bergferne Orte in die Alpen eingeschrieben und damit diese zu „ihrem“ Raum gemacht haben. Ein Beispiel ist die Berliner Hütte.
Kommen wir zum Schluss noch einmal zu dem zurück, was die Berge mit dem Denken verbindet: Was ist denn der beste Berg für schwierige Entscheidungen?
Für mich ist das der Untersberg. Von da kann ich auf meine verschiedenen Lebensdestinationen schauen: die Berchtesgadener Region, Salzburg und in alle Richtungen, in die ich regelmäßig aufbreche.
Und was ist der beste Berg, um den Kopf freizubekommen?
Wenn ich hier den Kopf freikriegen muss, dann gehe ich auf den Steinberg. Das hat einen ganz pragmatischen Grund: Ich kann direkt von meinem Büro aus starten.
ZUR PERSON
Jens Badura setzt sich in seiner Arbeit (sowohl im berg_kulturbüro als auch im creativealps_lab) mit der Entwicklung von Bergregionen auseinander. Er arbeitet auch als Bergwanderführer und ist Mitglied der Bergrettung Salzburg.
 Berg & Freizeit
Berg & FreizeitPodcast Folge 46: Was opfern wir den Rekorden?
 Berg & Freizeit
Berg & FreizeitBergwelten Podcast: Wie schnell verändern sich die Berge?
 Alpinwissen
AlpinwissenBücher, die wir bis auf den Gipfel tragen
 Berg & Freizeit
Berg & FreizeitDer Maler Herbert Brandl über den Traum vom leeren Berg
 Berg & Freizeit
Berg & FreizeitKann ich von den Bergen ein Burn-Out bekommen?
 Berg & Freizeit
Berg & Freizeit„Die Taliban wissen, wie stark wir sind"